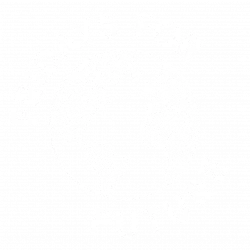Am 3. März 2023 gehen wir zusammen auf die Straße. Es ist der 12. Globale Klimastreik. Doch warum streiken wir eigentlich? Manuel fasst die Hintergründe des Streiks ausführlich zusammen.
Die Lage der Klimagerechtigkeitskrise hat sich nicht verbessert. Während mit 2022 ein Jahr des Krieges, des Unrechts und der Negativrekorde in Sachen Klimakrisefolgenkatastrophen zu Ende ging, ist der Politik der Kurswechsel zu mehr Klimagerechtigkeitspolitik nicht gelungen. Gewiss mag hierfür auch der Angriffskrieg des Putin-Regimes in Russland verantwortlich sein. Wir können uns aber ein weiteren Zuwarten nicht erlauben und brauchen dringend die klimagerechten Wenden, um die schlimmsten Folgen der Klimakrise abzumildern, wenn wir diese nicht mehr abwenden können. Die hierfür notwendige Klimagerechtigkeitspolitik möchten wir am 3. März 2023 zusammen mit dir auf unseren Versammlungen einfordern.
Konkret fordern wir die Mobilitätswende, die Energiewende und eine global gerechtere Außen- und Finanzpolitik, welche die Kosten und Nachteile zur Abwendung der Klimakrisefolgenschäden, zugunsten der Staaten, welche die Klimakatastrophe am wenigsten verursacht haben, gerecht ausgleicht.
Zwei Schlüssel zu mehr Klimagerechtigkeit bilden in der Bundesrepublik Deutschland die Energiewende und die Mobilitätswende. Der Sektor Energie gilt als größter Emittent von Treibhausgasen, der Verkehrssektor als drittgrößter Emittent. Die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern muss deswegen in beiden Bereichen so schnell wie möglich reduziert werden.
Die infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine erfolgte Reduktion des Bezugs fossiler Energieträger aus Russland darf nicht dauerhaft durch den Bezug von fossilen Energieträgern aus anderen Staaten ersetzt werden. So darf der Bau von Terminals und Pipelines für den Bezug von Flüssiggas und Öl aus anderen Staaten, insbesondere mit autokratischen Regimen, nur eine Notlösung sein, um kurzfristig befürchtete Engpässe von Energien zu überbrücken, nicht aber die Fortsetzung einer langfristigen Abhängigkeit von fossilen Energieträgern etablieren. Eine solche Abhängigkeit lässt sich nur vermeiden, wenn fossile Energieträger durch Energieträger, die nicht fossil sind, ersetzt werden. Der Ausbau und die Anschlüsse von Anlagen, die Energie aus erneuerbaren Energieträgern, insbesondere aus Wasser, Sonne und Erdwärme erzeugen und der Ausbau der Nah- und Fernwärmenetze müssen energiepolitisch Priorität haben und beschleunigt werden. Wir benötigen den schnellstmöglichen Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern – Kohle, Öl und Gas. Der Kohleausstieg muss spätens bis 2030 vollzogen sein.
Der Verkehrssektor soll nach den Sektoren Energie und Industrie für den drittgrößten Anteil an den Treibhausgas-Emissionen in der Bundesrepublik verantwortlich sein. Die Emissionen nehmen derzeit trotz Steigerung der Energieeffizienz von Fahrzeugen zu. Verantwortlich hierfür ist die Zunahme des Verkehrs. Einer modernen, arbeitsteilige und vernetzten Gesellschaft kann ein Mindestbedarf an Mobilität nicht abgesprochen werden. Deswegen benötigen wir einen Wandel, der nicht nur mit einer Effizienzsteigerung und Reduktion der Treibhausgas-Emission aufgrund der Beschaffenheit der benutzten Fahrzeuge verbunden ist, sondern auch mit der Reduktion der individuellen Nutzung der Fahrzeuge. Um diese zu erreichen sind der Ausbau des öffentlichen Personenverkehrs und die Steigerung der Zugänglichkeit zu diesem und dessen Attraktivität unumgänglich. Leider scheint dies der Politik, insbesondere dem Bundesverkehrsminister, nur unzureichend bewusst zu sein. So setzt man sich im Bundesverkehrsministerium neben dem Ausbau des öffentlichen Personenverkehrs (ÖPV) für den schnelleren Neubau von Autobahnen ein. Bleibt die Nutzung des Individualverkehrs weiterhin wesentlich attraktiver als der öffentliche Personenverkehr, werden viele Menschen weiterhin den Individualverkehr bevorzugen. Der ÖPV bedarf deswegen Veränderungen, die seine Attraktivität steigern. Einerseits muss er stärker ausgebaut werden. Die Zugänglichkeit und das Angebot in ländlichen Regionen müssen größer sein. Barriefreiheit muss an allen (Halte-)Stellen und Umstiegepunkten und in allen Fahrzeugen, die im ÖPV zur Erbringung von Beförderungsdienstleistungen, bestimmt sind, selbstverständlich sein. Die Kosten für die Nutzung des ÖPV müssen im Vergleich zum Individualverkehr sinken. Eine Fahrt mit dem ÖPV darf nicht so viel kosten wie eine Tankfüllung eines PKW, mit der sich das vier- oder fünffache der Entfernung zurücklegen lassen kann. Personen, die den ÖPV nutzen, dürfen nicht im Nirgendwo stranden. Haltestellen und Umstiegemöglichkeiten ohne ausreichende Beleuchtung, Sicherheit, Ansprechpersonen, Schutz vor Witterung und sanitäre Einrichtungen müssen der Vergangenheit angehören.
Zur Attraktivität des öffentlichen Personenverkehrs gehören nicht nur Zuverlässigkeit, Zugänglichkeit, Barrierefreiheit, Schnelligkeit, Flexibilität, Sauberkeit sondern auch gute Arbeitsbedingungen. Nur wenn genügend Personal vorhanden ist, welches neben Wertschätzung ein anständiges Entgelt für seine Arbeit erhält, haben Unternehmen, die im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs Beförderungsleistungen erbringen, die personellen Ressourcen, die sie benötigen, um einen zuverlässigen, qualitativen und freundlichen Service auf hohen Niveau anbieten zu können. Wir müssen, den Personen, die im ÖPV arbeiten, bessere Arbeitsbedingungen geben und eine bessere Bezahlung. Das Anliegen der Gewerkschaften, die sich für bessere Arbeitsbedingungen im ÖPV einsetzen, ist deswegen nur gerecht. Wir unterstützen dieses. Ein funktionierender und attraktiver ÖPV mit guten Arbeitsbedingungen ist im allgemeinen öffentlichen Interesse.
Zur Abwendung der Klimakatstrophe ist die Einhaltung der Pariser Verträge erforderlich. Das 1,5°C-Ziel sollte weiterhin erreicht werden. Sollte dieses verfehlt werden, so muss die Staatengemeinschaft gemeinsam um jedes Zehntelgrad kämpfen. Jedes Zehntelgrad Erwärmung entscheidet über den Eintritt oder Nichteintritt von Katastrophen infolge der Klimakatstrophe, welche die Lebensgrundlagen von Menschen zerstören können. Die Staaten sind in unterschiedlicher Weise von der Klimakatastrophe betroffen. Es gibt Staaten, welche weniger zur Klimakatstrophe beigetragen haben, als Staaten, die stärker zu ihr beigetragen haben. Entsprechendes gilt hinsichtlich Ressourcen, um sich gegen die Folgen der Klimakatastrophe zu schützen. Hieraus resultiert ein ungerechtes Ungleichgewicht, das die internationale Staatengemeinschaft ausgleichen muss. Deswegen muss den Staaten, die am stärksten von der Klimakrise betroffen sind, aber am wenigsten zu ihr beigetragen haben, der entstehende Schaden ersetzt werden. Wenn und soweit diese Staaten Schulden haben, die ihre finanziellen Möglichkeiten einschränken und den Aufbau von Rücklagen verhindern, müssen diese erlassen werden. Die Bundesrepublik Deutschland muss als einer Staaten, welcher am meisten zur Klimakatastrophe beigetragen hat, mindestens 14 Milliarden Euro zur internationalen Finanzierung des Klimaschutzes und zur Maßnahmen zum Schutz gegen nachteilige Folgen der Klimakatastrophe bereitstellen, welche den Staaten zugute kommen müssen, die am stärksten von dieser betroffen sind und am wenigstens zu dieser beigetragen haben.
Für diese Ziele, die Einhaltung des 1,5°C-Ziels und eine lebenswertere (Um-)Welt gehen wir am 3. März 2023 auch in Deiner Stadt auf die Straße. Sei dabei, schließe Dich uns an!