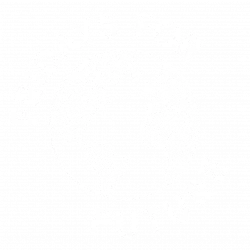Noch können wir die menschengemachte Erderwärmung unter 1,5°C begrenzen. Aber dafür sind tiefgreifende Veränderungen nötig. Und das möglichst bald. Dafür ist dieses Jahr entscheidend: Bundestagswahl und COP26 bergen die Möglichkeit für Veränderung und am 24.09. gehen wir wieder weltweit auf die Straße für eine klimagerechte Gesellschaft. Deshalb haben wir Aktivist*innen und Expert*innen gefragt, was sie antreibt, ihnen Mut macht für die Zukunft und in welcher Welt sie leben wollen. Im vierten Teil unserer Artikelreihe „Sommer der Utopien“ beschreibt die Aktivistin Indigo, warum Umwelt zerstört, Menschen unterdrückt und ausgebeutet werden, obwohl das Leid so offensichtlich ist und schon so viele Menschen versuchen, etwas dagegen zu tun. Aber auch, warum sie statt in die Parlamente in die vom Braunkohletagebau bedrohten Dörfer gegangen ist und wie eine Gesellschaft ohne zerstörerische Strukturen aussehen kann.
Morgens um neun tönt ein Saxofon durch die Baumwipfel. Der Klang schallt durch die verzweigten Baumkronen, fließt durch die hellgrünen, frisch aus den Knospen gesprungen Blätter des Frühlings. Unten, am Boden, ist Lachen zu hören. Es sind schon Menschen in der Küche. Das Saxofon ruft zum Frühstück. Und zum Plenum.Dort entscheiden wir gemeinsam, was den Tag über ansteht und wer welche Aufgaben übernimmt.In kleinen Zügen organisieren wir uns hier so, wie wir es uns gesamtgesellschaftlich für eine klimagerechte Welt vorstellen könnten. Nicht, dass alle morgens um neun Plenum machen sollten. Sondern dass Menschen zu dem beitragen was ihnen wichtig ist und unabhängig davon das bekommen, was sie brauchen. Frühstück, ein zu Hause, emotionale Fürsorge oder neue Schuhe.
Das Baumhausdorf Unser Aller Wald haben wir vor fast einem Jahr aufgebaut. Das Wäldchen säumt das Dorf Keyenberg. Eines von sechs Dörfern, die noch dem Braunkohletagebau Garzweiler weichen sollen. Damals, als bekannt wurde, dass Menschen aus der Klimabewegung für die Grünen im Bundestag kandidieren wollen, haben wir beschlossen nicht in die Parlamente zu gehen, sondern in die bedrohten Dörfer.Wir sind überzeugt, dass eine klimagerechte Welt nicht von der Regierung geschaffen werden kann. Um das zu verstehen, müssen wir aber, bevor wir zu der so wichtigen Frage kommen, was eigentlich Klimagerechtigkeit ist, eine andere Frage stellen: Warum ist die Welt so klimaungerecht? Warum wird Umwelt zerstört, werden Menschen unterdrückt und ausgebeutet, obwohl das Leid so offensichtlich ist und schon so viele Menschen versuchen, etwas dagegen zu tun?
100 Unternehmen sind verantwortlich für 71% der globalen CO2 Emission. Wenn wir also nach den Ursachen der Klimazerstörung suchen, dann scheint es sinnvoll, uns die Wirtschaft anzuschauen. Die Art wie unsere Gesellschaft das produziert und reproduziert was wir zum Leben brauchen. So wie unsere Wirtschaft organisiert ist, entscheiden nicht wir, was produziert wird. Vielen Menschen die in der Automobilindustrie arbeiten ist zum Beispiel Klimaschutz wichtig und einige würden sicher lieber etwas anderes produzieren. Aber sie haben keine Möglichkeit das zu beeinflussen. Sie werden bezahlt um Autos zu bauen. Und wenn sie sich weigern das zu tun, dann verlieren sie ihren Job. Wir sind aber innerhalb dieser Verhältnisse auf einen Job angewiesen und die meisten werden versuchen einen zu bekommen und zu behalten, der ihnen möglichst viel Sicherheit und gute Bezahlung bringt. Nicht weil sie egoistisch sind, sondern einfach weil sie versuchen, so gut wie möglich ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Deswegen werden Menschen, so lange sie gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, um zu überleben, eben auch Autos bauen, wenn sie dafür bezahlt werden.
Wenn wir, falls wir irgendwo arbeiten, also nicht entscheiden was produziert wird, wer entscheidet es dann? Auf den ersten Blick könnte die Antwort sein: Der Chef. Er ist es, der uns Arbeitenden die Anweisungen gibt und durch unsere Arbeit reich wird, während dabei die Lebensgrundlage von so vielen zerstört wird. Allerdings ist auch diese Antwort nicht hinreichend. Denn der Chef könnte in den meisten Fällen nicht einfach entscheiden, die Umwelt nicht zu zerstören oder seine Arbeitenden gut zu bezahlen. Denn auch er ist gezwungen, den Profit so sehr es geht zu maximieren. Das liegt daran, dass er sich in Konkurrenz zu anderen Produzierenden befindet. Wenn er nicht so profitabel wie möglich produziert und einen Teil des Profites reinvestiert, dann haben die anderen einen Wettbewerbs -Vorteil. Er wird vom Markt verdrängt. So dient unsere Produktion vor allem der Bewegung des Geldes. Aus Geld muss mehr Geld gemacht werden. Dabei werden auch Bedürfnisse befriedigt. Allerdings nur, wenn es profitabel ist, wenn es zahlungskräftige Bedürfnisse sind. Und das sind viele nicht. Gerade in Ländern des globalen Süden, wo auf Grund von kolonialer Kontinuität und legitimiert durch den immer noch anhaltenden Rassismus, die Voraussetzung um auf dem globalen Markt zu konkurrieren nicht gut sind, werden Grundbedürfnisse, wie die nach Wohnraum, Gesundheitsversorgung oder Ernährung nicht befriedigt. Da nur die Bedürfnisse derer befriedigt werden, die dafür bezahlen können, kommt es zu dieser unfassbaren Absurdität, die längst so normal scheint, dass kaum jemand deshalb noch schreit oder weint: Die Koexistenz von größtem Reichtum und schwerster Armut.
Durch die Klimakrise werden diese Mechanismen noch einmal verschärft und sichtbarer. Die Menschen, die am wenigsten zu der Krise beigetragen haben, sind am stärksten von ihr betroffen und haben kaum Ressourcen um sich gegen sie zu wehren.
Unsere Art zu wirtschaften tötet also uns und unseren Planeten. Und weder die Arbeitenden noch die Chefs scheinen innerhalb dieser Strukturen wirklich in der Lage zu sein, etwas daran zu ändern. Deswegen appellieren auch Umweltverbände meist an einen anderen Akteur, der auf den ersten Blick die Macht zu haben scheint, die Wirtschaft in die Schranken zu weisen: Den Staat. Die Regierung. Sie soll regulierend eingreifen und all die schrecklichen Folgen, die diese Art Produktion zu organisieren mit sich bringt, abfedern. So dass niemand verhungert und unsere Lebensgrundlage erhalten bleibt. Das Problem ist, dass auch der Staat nur bedingt außerhalb der Logik der Kapitalverwertung steht. Für alles was der Staat tut braucht er Steuereinnahmen. Und die bekommt er, wenn es der Wirtschaft gut geht. Zusätzlich stehen auch Staaten zueinander in Konkurrenz. In der Standortkonukurrenz versuchen sie Unternehmen dazu zu kriegen, sich bei ihnen niederzulassen, statt in anderen Staaten. Umweltschutzgesetzte oder Arbeitsrecht stehen dem immer im Weg. Der Staat ist also abhängig von der Wirtschaft und wird immer versuchen, gute Rahmenbedingungen für diese zu schaffen und nicht für die Befriedigung unserer Bedürfnisse oder den Erhalt unserer Lebensgrundlage. So ist es verdammt schwer, die Klimakrise aufzuhalten.
Deswegen haben wir uns also entschieden, statt in die Parlamente in die bedrohten Dörfer zu gehen. Weil wir glauben, dass die Parlamente innerhalb dieser Wirtschaftsweise die Klimakrise nicht aufhalten können. Das einzige was in diesen Zeiten realistisch zu sein scheint ist, was im ersten Moment so unrealistisch wirkt: Eine ganze neue Weise zu fordern, Gesellschaft zu organisieren.Nach Bedürfnissen und Fähigkeiten statt Profit und Konkurrenz. Der Aufbau einer wirklich klimagerechten Welt.Bei Klimagerechtigkeit geht es nicht um einzelne Maßnahmen der CO2 Reduktion. Es geht viel mehr darum, die Strukturen aufzuheben, die die Klimakrise und die damit einhergehende Ungerechtigkeit überhaupt erst möglich gemacht haben.
Wie könnte also eine Gesellschaft ohne diese Strukturen aussehen?
So schön das Beispiel unseres Baumhausdorfes und der Saxofonklänge am Morgen auch ist, so unbrauchbar ist es auch. Denn es führt dazu, dass wir uns Gesellschaft vereinzelt vorstellen, Utopie als viele kleine Gruppen, die, getrennt vom Rest der Welt, in Wäldern sitzen. Diese, in kleine Gemeinschaften zersprengte Gesellschaft, könnte nur recht simple Sachen herstellen. Sie wäre dabei zwar vielleicht umweltfreundlich, allerdings geht es bei Klimagerechtigkeit nicht darum, die Umwelt zu retten und dabei ein nicht lebenswertes Leben für Menschen zu schaffen. Genau das würde es bedeuten, die Gesellschaft auf zersprengte autarke Gemeinschaften herunterzubrechen. Denn dann könnten wir keine Medizin mehr produzieren, keinen Strom, keine schnellen Transportmittel. Und müssten vermutlich von morgens bis abends schuften.
Das heißt, es gilt dieses schöne Bild zu übersetzen. Es auf die gesamte Gesellschaft als eine Gemeinschaft zu übertragen. Diese Weltgemeinschaft würde ihre Entscheidungen selbstverständlich nicht in einem Plenum am Morgen treffen, sondern dezentral und doch vernetzt an vielen verschiedenen Stellen, dort wo Menschen zusammen Sachen produzieren, wohnen und leben.
Dabei müsste sie, um nicht im alten verhaftet zu bleiben, auf den selben Grundzüge aufbauen, wie unser Baumhausdorf: Darauf, dass Menschen tätig sind, weil sie motiviert dazu sind und nicht weil sie gezwungen werden. Und darauf, dass sie über das verfügen können was sie brauchen. Diese Grundzüge können sich auch erst auf gesellschaftlicher Ebene tatsächlich entfalten. Denn nur dort gäbe es so viele Arten tätig zu werden und so viele Menschen mit produktiven Bedürfnissen, dass es wahrscheinlich wird, dass es für alles was notwendig ist jemand findet, der motiviert es, es zu tun. Und nur dann gäbe es die Möglichkeit Dinge so produktiv herzustellen, dass wir alle Menschen gut versorgen können und dabei noch einen Haufen freie Zeit übrig bleibt.
Die Menschen, die in dieser Gesellschaft leben werden, vielleicht auch wir in der Zukunft, werden sicher spannende Techniken entwickeln und Maßnahmen ergreifen, um zu leben, ohne das Klima zu zerstören und die Umwelt zu verseuchen. Manchmal träume ich von riesigen Segelbooten deren Segel durch Photovoltaik auch Strom produzieren, um die Batterie eines Schiffsmotors zu laden (Nur das die wohl nicht ich entwerfen und bauen werden, sondern Menschen die sich tatsächlich damit auskennen. Aber wer weiß, vielleicht werde ich ja noch Ingenieurin, wenn ich keine Revolutionärin mehr sein muss.). Eine Freundin von mir träumt davon, eine App zu schreiben, die in Echtzeit verschiedenste Bedürfnisse miteinander und mit den ökologischen Bedingungen abgleicht, bündelt und an die Produktionskollektive übermittelt.
Viele Techniken und konkrete Maßnahmen wurden auch schon entwickelt. Und natürlich können auch einige von ihnen, wie zum Beispiel die Umstellung auf erneuerbare Energien, schon im Bestehenden umgesetzt werden. Deswegen kämpfen wir auch hier vor Ort schon für jede Maßnahme, die uns mehr Zeit bringt. Allerdings werden ein Großteil der guten Ideen und Maßnahmen zum Klimaschutz unter den jetzigen Bedienungen nicht umgesetzt werden und viele auch gar nicht erst entwickelt. Nicht, weil das Wissen fehlt, sondern weil sie schlicht nicht profitabel sind.
Deswegen reicht es nicht, sich politisch für die Umsetzung konkreter Maßnahmen einzusetzen. Statt dessen ist es Zeit endlich zu fragen, in was für einer Welt wir eigentlich leben wollen. Und Dinge die und als vermeintlich natürlich verkauft werden in Frage zu stellen. Es ist Zeit, dass wir nicht nur dafür kämpfen, größeren Schaden abzuwenden, sondern für eine Gesellschaft, in der es sich zu leben lohnt. Nichts ist unrealistischer, als das alles bleibt wie es ist.
Zur Autorin: Indigo besetzt seit einige Jahren Bäume und Bagger für Klimagerechtigkeit, schreibt Texte und hält Vorträge, organisiert Kampagnen und dreht Youtube-Videos. Sie ist organisiert im Solidarnetz und lebt in Unser Aller Wald (@UnserAllerWald).