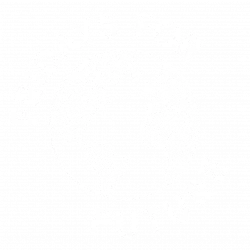Hitzewelle, Waldbrände und politisches Versagen – unsere Autorin Paula ordnet die letzten Tage klimapolitisch ein.
Die letzten Tage haben mich richtig schockiert: Mit Temperaturen von bis zu 38°C und Nächten, in denen nichts abkühlte, haben wir einen harten Ausblick auf die Realität der Klimakrise bekommen. Im selben Moment hat Merz mit seinem Kabinett alles dafür gegeben, diese Krise weiter anzufeuern – am bisher heißesten Tag des Jahres hat das Bundeskabinett die Förderung von neuem Gas beschlossen.
Diese Klimapolitik ist einfach nur noch komplett absurd. Wir erleben es ja alle: Ich habe in der letzten Woche so viele Krankenwagen und Feuerwehreinsätze gesehen, wie lange nicht mehr. In Sachsen und Thüringen brennen die Wälder, die Züge stehen still und Autobahnen sind verstopft, weil die Hitze unsere Infrastruktur überlastet. Meine Oma hat sich tagsüber nicht aus dem Haus getraut. Und selbst in meinem engsten Freundeskreis gab es einen Hitzeschlag – wir alle hatten alle Hände voll damit zu tun, uns um uns und unsere Liebsten zu kümmern. Unser aller Feeds und Nachrichten waren voll mit Tipps, wie man die Hitze übersteht. Aber die ganze Zeit hatte ich das Gefühl, dass niemand das Wichtigste sagt: Diese Hitzewelle ist die Folge einer Politik, die uns jahrzehntelang im Stich gelassen hat. Es ist an uns, das zu benennen.
Diese Hitzewelle ist weder ein einmaliges Ereignis, noch ist sie Normalität. Sie ist das Ergebnis einer Politik, die lieber Kohle, Öl und Gas verbrannt und damit eine fossile Wirtschaft gestärkt hat, als unsere Lebensgrundlagen zu sichern. Das Leid, das diese Politik auslöst, ist in den letzten Tagen mit voller Wucht bei uns angekommen. Für viele andere Menschen weltweit ist es schon lange Realität. Doch dass aus dieser Krise zu lernen kein Selbstmechanismus ist, haben Friedrich Merz und Katherina Reiche in den letzten Tagen klar gezeigt: Sie bleiben auf ihrem fossilen Kurs und haben den Weg freigemacht für Gasbohrungen vor der Nordseeinsel Borkum. Die fossilen Projekte, die darauf folgen werden, stehen in Bayern und Baden-Württemberg schon in den Startlöchern. Im Gegensatz zu anderen Ländern, die sich auf zukünftige Extremhitze vorbereiten, hat Deutschland noch keinen Plan, wie die Menschen hier vor den Folgen der Klimakrise geschützt werden sollen. Und indem sie die deutschen Klimaziele anzweifelt, präsentiert sich Wirtschaftsministerin Katherina Reiche mitten in der Krise zum Gesicht der fossilen Lobby. Wir müssen darüber reden, welche politische Dimension die Hitze der letzten Tage hat, damit wir eine Politik verhindern können, die solche Katastrophen weiter vorantreibt.
Wir arbeiten gerade daran, Protestaktionen zu organisieren. Dafür brauchen wir dich: Gerade wenn die Klimakrise erfahrbar wird, ist wichtig, dass wir darüber sprechen, was sie anfeuert. Die Zusammenhänge zwischen politischen Entscheidungen und der unertragbaren Hitze sind vielleicht nicht offensichtlich, aber wir kennen sie – und das heißt, dass wir etwas tun können. Denn Protest beginnt mit unserem Wissen darüber, dass die Dinge nicht so sein müssen, wie sie sind. Er beginnt mit unserer Wut und den Aktionen, die wir daraus aufbauen. Lass uns wütend sein!