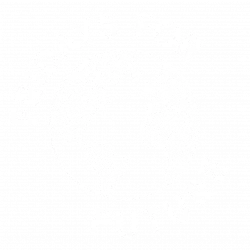Er wird oft als Ausweg aus der Klimakrise beschrieben, ist die Hoffnung fast aller Industriezweige und wird wegen seines hohen Energiebedarfs trotzdem kritisch gesehen: Wasserstoff ist das leichteste und häufigste Element im gesamten Universum, wird im Klimakontext aber zum Gegenstand einer komplexen Auseinandersetzung. Grund genug, uns in diesem Text einmal genauer damit zu befassen.
Welche Arten von Wasserstoff gibt es?
Grüner Wasserstoff entsteht, wenn Wasser in einem Elektrolysator in seine Bestandteile, also Sauerstoff und Wasserstoff aufgespalten wird. Um die chemische Reaktion in Gang zu setzen, wird Strom benötigt, der für die Klassifizierung als grüner Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen stammen muss. Entstehen dann auch beim Transport des Wasserstoffs keine Emissionen, ist dieses Verfahren klimaneutral.Wird bei der Elektrolyse hingegen Strom aus fossilen Energieträgern eingesetzt, handelt es sich um grauen Wasserstoff. Grauer Wasserstoff kann aber auch durch die sogenannte Dampfreformierung erzeugt werden, bei der Wasserstoff von Erdgas abgespalten wird. Dabei entsteht als Abfallprodukt unter anderem CO₂, auch dieses Verfahren ist also nicht besonders klimafreundlich.Wird das CO₂, das bei der Dampfreformierung freigesetzt wird, aber aufgefangen, bevor es in die Atmosphäre gelangt, ist von blauem Wasserstoff die Rede. Mithilfe der CCS-Technik (Carbon Capture and Storage) wird das abgeschiedene CO₂ dann unter der Erde verpresst. Diese Technik kann aber bisher nur kleine Mengen an Treibhausgas verarbeiten und ist obendrein noch stark umstritten, weil unklar ist, ob das CO₂ überhaupt dauerhaft eingeschlossen werden kann, und sie schlecht erforschte ökologische Risiken mit sich bringt.Eine weitere Alternative stellt türkiser Wasserstoff dar, der mittels Pyrolyse aus Erdgas hergestellt wird. Dabei entsteht kein CO₂, sondern fester Kohlenstoff, der in manchen Industriebranchen ohnehin benötigt wird. Das Verfahren benötigt weniger Energie als die Elektrolyse, allerdings müsste die Wärme, die für den Prozess erforderlich ist, natürlich auch erneuerbar sein. Außerdem ist dieses Verfahren noch lange nicht praxistauglich.
Wie kann Wasserstoff verwendet werden?
Zum einen kann Wasserstoff einfach verbrannt werden, auf diese Weise wird er zum Beispiel bereits seit den 1950er Jahren als Raketentreibstoff verwendet. Aber auch in Heizungen, Verbrennungsmotoren oder Kraftwerken kann Wasserstoff auf diese Weise eingesetzt werden. Und schon heute können geringe Mengen Wasserstoff ganz normalem Erdgas oder Kerosin beigemischt werden, um die Klimabilanz von Heizungen und Flugzeugen zumindest um ein paar Prozent zu verbessern.Alternativ kann er aber auch in einer Brennstoffzelle zum Einsatz kommen. Grob gesagt wird dort der Prozess aus der Elektrolyse einfach umgedreht: Aus Wasserstoff und Sauerstoff wird wieder Wasser, gleichzeitig fließt aber auch Strom, der dann für verschiedenste Zwecke eingesetzt werden kann, zum Beispiel in den Elektromotoren von Wasserstoffautos.Eine dritte Möglichkeit ist die Nutzung zur Herstellung synthetischer Kraftstoffe. Dabei wird im Labor aus Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid ein herkömmlicher Kraftstoff erzeugt (z.B. Benzin oder Kerosin), der dann in ganz normalen Verbrennungsmotoren verbrannt werden kann. Wird dafür CO₂ aus der Atmosphäre entnommen und werden sowohl für die Herstellung als auch den Transport des Kraftstoffs nur erneuerbare Energien verwendet, gelangt durch diesen Prozess in Summe kein zusätzliches CO₂ in die Atmosphäre.Abgesehen davon wird Wasserstoff in der Industrie schon heute für verschiedene Zwecke benötigt, zum Beispiel als Schutzgas oder zur Entschwefelung in Raffinerien. Dafür wird bisher aber fast ausschließlich grauer Wasserstoff verwendet.
Wo ist der Haken?
Wie oben erwähnt, ist Wasserstoff immer nur so klimafreundlich wie der Strom, mit dem er produziert wird. Die Menge an Strom, die für seine Herstellung benötigt wird, ist aber immens. Der Verband der chemischen Industrie VCI beziffert den Strombedarf für die komplette Umstellung der chemischen Industrie auf Wasserstoff beispielsweise auf 682 Terawattstunden pro Jahr, das ist mehr als der gesamte deutsche Stromverbrauch und fast das Dreifache der 251 TWh Strom, die 2020 aus erneuerbaren Quellen erzeugt werden konnten.Genauso sieht es im Verkehrsbereich aus: Selbst der Umstieg auf Elektroautos bedeutet schon einen zusätzlichen Strombedarf von 200 TWh pro Jahr, bei der Brennstoffzelle steigt die Menge dann aber noch weiter. Während ein batteriebetriebenes Elektroauto im Fahrbetrieb nämlich einen Wirkungsgrad von über 75% hat, liegt der bei Autos mit Brennstoffzelle nur noch bei ca. 25-30%. Folgerichtig wird etwa die zweieinhalb- bis dreifache Menge an Strom benötigt, um die selbe Strecke zu fahren. Noch schlimmer sieht es bei den synthetischen Kraftstoffen mit einem Wirkungsgrad von ungefähr 13% aus, die einen um 1000 TWh gestiegenen Strombedarf bedeuten würden. Für die Umstellung der deutschen Flugfahrtbranche auf synthetisches Kerosin kommen dann noch einmal 270 TWh obendrauf.Und auch Heizungen mit Wasserstoff zu betreiben, ist vergleichsweise ineffizient: Pro kWh erneuerbarem Strom können hier 0,6 kWh Erdgas ersetzt werden, mit einer Wärmepumpe dagegen ganze 3,3 kWh, also mehr als das Fünffache.Die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung sieht aktuell vor, den benötigten grünen Wasserstoff, der nicht in Deutschland selbst hergestellt werden kann, einfach aus anderen Ländern zu importieren. Ein solcher Import aus Ländern, die erneuerbare Energien im Überfluss herstellen können, kann zwar durchaus sinnvoll sein, dafür müssen aber bestimmte Bedingungen erfüllt sein: Erstens darf der Export von Wasserstoff nicht zu Lasten der eigenen Bevölkerung gehen, das heißt, sie muss selbst bereits ausreichend mit Strom versorgt sein und auch das benötigte Wasser und die verwendeten Flächen und Ressourcen dürfen nicht zu einer Knappheit wichtiger Güter führen. Zweitens muss das Land sich selbst mit 100% erneuerbaren Energien versorgen können, denn wenn der Export von erneuerbarem Strom in Form von Wasserstoff zum Neubau oder Weiterbetrieb von fossilen Kraftwerken im Exportland führt, ist durch die Verwendung von Wasserstoff in Deutschland nichts gewonnen. Und drittens müssen Menschenrechtsverletzungen bei der Herstellung des Wasserstoffs natürlich ausgeschlossen werden können.
Wo kann Wasserstoff sinnvoll eingesetzt werden?
Im Endeffekt überall da, wo es keine sinnvolle Alternative gibt. Das gilt vor allem für die Luft- und Schiffsfracht und in der Herstellung von Stahl und chemischen Grundstoffen. Auch in Fernwärmenetzen oder auf Bahnstrecken ohne Oberleitung kann Wasserstoff nützlich sein.Allerdings sollte die Einführung von Wasserstoff auch in diesen Bereichen immer mit zusätzlichen Maßnahmen einhergehen, um die benötigte Menge so klein wie möglich zu halten. Der BUND schätzt zum Beispiel, dass die Chemieindustrie ihren Strombedarf zur Umstellung auf Wasserstoff durch entsprechende Einsparungsmaßnahmen von den vorhin genannten 682 TWh auf etwa 100-150 TWh reduzieren kann.Außerdem kann Wasserstoff zur Speicherung von überschüssigem Strom und damit zur Stabilisierung eines 100% erneuerbaren Stromnetzes eingesetzt werden. Auch da spielt die geringe Effizienz des Verfahrens aber eine Rolle, denn bei Herstellung, Transport und Nutzung des Wasserstoffs gehen jeweils Anteile des wertvollen Ökostroms verloren. Alternativen zur Wasserstoffspeicherung wären Batterie- und Pumpspeicher, auch die haben aber ihre Nachteile. Am Ende muss hier also zwischen verschiedenen Speichermöglichkeiten abgewogen werden, um für unterschiedliche Einsatzzwecke die jeweils beste Lösung zu finden.
Dieser Text basiert auf einem Beitrag aus dem wöchentlichen „Klimareport“ von FFF Ingolstadt. Wenn er euch gefallen hat, könnt ihr uns auf Telegram, WhatsApp oder per Mail an ingolstadt@fridaysforfuture.de abonnieren.