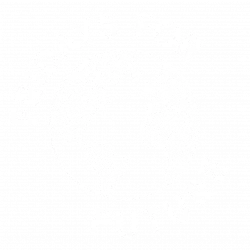Die Flutkatastrophen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und in Süd- und Ostasien lassen uns fassungslos zurück. Klimawissenschaftler*innen warnen seit Jahren und jetzt wieder, dass Extremwetterereignisse infolge der menschengemachte Erderwärmung häufiger werden. Aktivist*innen aus den betroffenen Gebieten appellieren an die Politik, jetzt zu handeln, damit sie so etwas nicht nochmal erleben müssen. Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland will mehr Klimaschutz. Und die Politik? Sie schönt die eigenen Bilanzen (Laschet). Sie kann sich nicht auf eine Beendigung der Kohleverstromung einigen (G20-Staaten) und verwässert und blockiert Klimaschutz (CDU/CSU). Sie nimmt eine unnötige Gas-Pipeline in Betrieb (deutsche Bundesregierung). Sophia und Lara haben euch die Klima-Nachrichten der letzten zwei Wochen zusammengefasst.
Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz
Mindestens 170 Todesopfer, hunderte Menschen weiterhin vermisst, weit über 700 Menschen verletzt, tausende Menschen, die ihr Zuhause verloren haben – die Folgen der Flutkatastrophe lassen uns fassungslos und traurig zurück.
Am Wochenende war in den Krisengebieten erneut Starkregen gemeldet, der aber laut Aussagen der Behörden in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zum Glück nicht zu größeren Problemen führte. Auch die Unwetter in Bayern führten im Vergleich zu den Unwettern der vorherigen Tage nicht zu größeren Schäden.
In den von der Flutkatastrophe betroffenen Gebieten laufen unterdessen die Bergungs- und Aufräumarbeiten. Wer vor Ort unterstützen möchte, sollte dies nicht einfach so auf eigene Faust tun, um keine Einsatzkräfte zu blockieren, sondern sich an lokale Ansprechpersonen werden. Diese, sowie Tipps für Spontanhelfer*innen sind auf der Website des Bundesamt für Katastrophenschutz zu finden. Zielgerichtet kann zudem durch Geldspenden geholfen werden. Eine übersichtliche Auflistung der Spendenkontos der einzelnen betroffenen Landkreise und weiterer Initiativen bietet beispielweise die Stuttgarter Zeitung.
Die Aufarbeitung der Katastrophe wird wohl noch lange dauern. Kinder- und Jugendpsychotherapeut Henning Dittkrist rät im Interview mit der taz, betroffenen Kindern das Gefühl zu vermitteln, jetzt in Sicherheit zu sein, sie von potentiell re-traumatiserenden Bildern und Videos fernzuhalten und bei lange anhaltendem veränderten Verhalten eine*n Kinder- und Psychotherapeut*in aufzusuchen. Während die Schäden der Flutkatastrophe vor Ort langsam ersichtlich werden, geht es auf politischer Ebene auch darum, wie solche Katastrophen in Zukunft verhindert werden können. Dass die Klimakrise Extremwettereignisse verstärkt und Naturkatastrophen häufiger werden lässt, ist hinreichend bekannt – doch aktuell gibt es keine ausreichend politische Antwort darauf. Julia und Jonas, Fridays for Future Aktivisti aus dem Ahrtahl, forderten bei unserer Pressekonferenz am Freitag die Politik auf, sich nicht weiter auf leeren Versprechen auszuruhen.
Katastrophenschutz muss besser werden
Wir müssen jetzt schnell Treibhausgas-Emissionen reduzieren und Klimaschutz voranbringen, um zu verhindern, dass wir in Zukunft noch häufiger mit Naturkatastrophen konfrontiert sind. Gleichzeitig muss auch das Krisenmanagement besser werden, um uns vor den bereits nicht mehr abwendbaren Folgen der Klimakrise zu schützen. Aktuell steht der Katastrophenschutz der NRW-Landesregierung unter heftiger Kritik. Die britische Hochwasser-Expertin Hannah Cloke, die das europäische Flutwarnsystem EFAS mitentwicklet hat, sagte, bereits am 10. Juli habe EFAS die deutsche und belgische Regierung gewarnt. In den folgenden Tagen hätte EFAS zudem detallierte Diagramme verschickt, welche Regionen am meisten betroffen sein würden. Doch die Warnungen seien nicht bei den Menschen angekommen. Armin Laschet, Ministerpräsident des stark betroffenen NRW, dagegen lobte die Einsatzkräfte in Hagen: Dort sei bereits ein Krisenstab eingerichtet worden, „als noch die Sonne schien und niemand erahnte, dass etwas passieren könnte“. Der Kanzlerkandidat ging noch auf Wahlkampf-Reisen, als die Katastrophengefahr der Landesregierung bereits bekannt gewesen sein soll. Fest steht: Warnsystem müssen in Zukunft besser funktionieren und es muss sichergestellt werden, dass die Warnungen die Menschen erreichen und verständlich sind, damit in Zukunft Menschenleben gerettet werden.
Armin Laschet und die Klimaschutz-Lüge
Während seines Besuchs in den Krisengebieten behauptete Armin Laschet, NRW sei der Vorreiter bundesweit was Klimaschutz angeht. Das ZDF hat diese Aussage anschließend einem Faktencheck auseinandergenommen. Zwar sanken die Treibhausgas-Emissionen in NRW zwischen 2017 und 2020 um 26%, was im Vergleich zum Bund mit nur 17% tatsächlich überdurchschnittlich ist. Doch laut Daten des statistischen Bundesamts ist NRW weiterhin Spitzenreiter bei energie-bedingten Emissionen. Der Pro-Kopf-Ausstoß ist hier mit 12 Tonnen CO2 pro Person deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von neun Tonnen pro Kopf. Dies liegt zu großen Teilen an der Kohle-Abhänigkeit NRWs. In einer Studie des renomierten Deutschen Insituts für Wirtschaftsforschung zur Anstrengung der Bundesländer in der Förderung erneuerbarer Energien und für den technologischen und wirtschaftlichen Wandel landet NRW bei der Förderung und Nutzung erneuerbarer Energien auf den hintersten Plätzen, nur das Saarland kann noch weniger Erfolg vorweisen. Erst in diesem Jahr beschloss zudem die schwarz-gelbe Landesregierung einen Mindestabstand von 1.000m für Windkraftanalagen, was den Ausbau neuer oder die Erneuerung alter Windkraftanlagen schwächen wird.
Starkregen und Überschwemmungen in China, Indien und den Philippinen
Nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern auch in China, Indien und auf den Philippinen wurden Menschen diese Woche von Starkregen und Überschwemmungen getroffen. In China fielen in der Stadt Zhengzhou, in der neun Millionen Einwohner*innen leben, und ihrem Umland die schwersten Regenfälle seit Jahrzehnten. In den Straßen floßen reißende Flüsse, die genug Kraft hatten, um Fahrzeuge wegzuschwemmmen. An vielen Orten war die Wasser- und Stromversorgung unterbrochen. Hunderte Menschen waren zwischenzeitlich in Zügen und Tunneln eingeschlossen, wo ihnen das Wasser zum Teil bis zu den Schultern stand. Nicht nur die Provinz Henan, sondern auch die Provinzen Zhejiang und Fujian hatten mit schweren Unwettern zu kämpfen. Ursache dafür sind Ausläufer des Taifuns In-Fa. Ein weiterer Taifun, Cempaka, sorgt unterdessen auch in Südchina, in der Provinz Guangdong für Unwetter und auch Nordchina ist betroffen. Bisher wurden 33 Tote gemeldet.
Auch in Indien sind unterdessen Menschen von starken Monsumregen und daraus resultierenden Überschwemmungen und Erdrutschen betroffen. Mindestens 124 Menschen sind Stand 25.07.2021 ums Leben gekommen. Weiterhin wird nach fast 100 Vermissten gesucht. Leider ist keine Entspannung in Sicht – die indischen Wetterbehörden warnten vor weiteren Regenfällen. Auch in Indien brechen die Regenfälle aktuell Rekorde. Im Bundesstaat Goa sind es die schlimmsten Regenfälle seit 1982. Laut dem Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) wird der Monsumregen in Indien immer stärker und unberechenbarerer werden, wenn die Erderwärmung ungebremst so weitergehen wird. „Für jedes Grad Celsius Erwärmung werden die Monsunregenfälle wahrscheinlich um etwa 5% zunehmen.“, sagt Anja Katzenberger vom PIK und der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU). Die Autor*innen der Studie warnen vor schwerwiegenden Folgen für das Wohlergehen, die Wirtschaft und das Nahrungsmittelsystem von mehr als einer Milliarde Menschen.
Auch die Philippinen sind von Monsumregen betroffen. Rund 25.000 Menschen mussten ihr Zuhause verlassen, mindestens vier Menschen kamen durch die schweren Unwetter ums Leben. Als Inselstaat gehören die Philippinen zu den am stärksten von der Klimakrise betroffenen Ländern. Sie werden jährlich von ca. 20 Taifunen getroffen. Menschen vor Ort berichten zudem, dass ihre Häuser mittlerweile nicht mehr nur bei Wirbelstürmen, sondern auch durch die Gezeiten überschwemmt würden.
Wir sind in Gedanken bei den Betroffenen und ihren Angehörigen und wünschen ihnen viel Kraft.
Klimaforscher*innen: Klimakrise und Extremwettereignisse hängen zusammen
Klimaforscher*innen warnen seit Jahren vor ihnen, rund um die Welt und hier bei uns erleben wir sie – mit tragischen Folgen: Die Klimakrise führt dazu, dass Extremwettereignisse schlimmer und häufiger werden. „Konkret zeigen die Simulationsrechnungen damals wie heute, dass leichte Niederschläge global durch den CO2-Anstieg in der Atmosphäre seltener werden, Starkregen dagegen häufiger vorkommt.“, schreibt Stefan Ramsdorf, Klima- und Meeresforscher vom Potsdam Institut für Klimafolgen-Forschung, im Spiegel. Und weiter: „Diese Zunahme von Extremregen ist nur eine von vielen Vorhersagen darüber, welche negativen Auswirkungen der Verbrauch von fossilen Brennstoffen hat, die inzwischen zur Realität geworden ist.“ Weltweite Messungen von Niederschlägen zeigen, dass Starkregenereignisse häufiger geworden sind. Und eine neue Studie im Fachmagazin „Nature Communications“ weißt den menschlichen Einfluss auf Extremwettereignisse nach. Eine weitere Studie der Newscastle University warnt, dass Starkregengebiete, die lange in einer Region bleiben, bei ungebremster Erderwärmung in Europa 14x-häufiger werden. Die Forschenden betonen: Es geht jetzt darum, Treibhausgase zu reduzieren und das Katastrophenmanagement verbessern.
Große Mehrheit wünscht sich mehr Klimaschutz
Zurzeit sehen 81% aller Bundesbürger*innen laut dem ARD-Deutschland-Trend großen oder sehr großen Handlungsbedarf beim Klimaschutz. Dies ist in allen Altersgruppen und überall im Land der Fall. Das letzte Mal, dass die Umfragewerte in ähnlicher Höhe lagen, war im Herbst 2019. Zudem sind Anhänger*innen aller großen Parteien, außer der AfD, der Meinung, dass großer oder sehr großer Handlungsbedarf besteht, mehr für den Klimaschutz zu tun.
Greenpeace-Analyse: Die 31 schlimmsten Klimabremser der großen Koalition
Wer aktuell Unionspolitiker*innen zuhört, kann sich schon wundern: Alle sind dafür, dass es beim Klimaschutz mehr Tempo geben soll: Ob Markus Söder, Angela Merkel oder Armin Laschet… Das klingt ganz wunderbar, wären es nicht genau CDU und CSU, die Deutschland in den letzten 16 Jahren regiert hätten. Greenpeace hat nun, circa drei Monate vor der Bundestagswahl, eine Analyse veröffentlicht, wer die größten Klimabremser der großen Koalition in den letzten vier Jahren waren. Dafür haben sie das Engagement (bzw. Nicht-Engagement) der relevanten Fachpolitiker*innen, hochrangiger Regierungsvertreter*innen aus CDU, CSU und SPD und Ministerpräsident*innen mit großem innerparteilischen Einfluss unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse könnt ihr hier nachlesen. Kleiner Spoiler: Alle zuvor genannten Unions-Politiker*innen finden sich in der Liste, aber auch einige SPD-Politiker*innen haben ihren Auftritt.
G20 können sich nicht auf mehr Klimaschutz einigen
Eine Nachricht, die sich anfühlt, wie ein Schlag ins Gesicht all derjeniger, die sich seit Jahren um unsere Gegenwart und Zukunft sorgen: Auf ihrem Treffen in Neapel konnten sich die G20-Staaten nicht auf mehr Klimaschutz einigen. Die G20-Treffen sind ein informelles Forum der zwanzig Staaten, die über 80% des globalen Bruttoinlandsprodukts und des globalen CO2-Ausstoß ausmachen. Sie haben also eine enorme Verantwortung in dieser Krise. Doch die G20-Staaten schafften es gerade einmal, sich nochmals zu den Pariser Klimazielen, die sie schon lange unterzeichnet hatten, zu bekennen. Ein Bekenntnis, die Emissionen bis 2030 soweit zu reduzieren, dass das 1,5°C-Limit nicht überschritten wird, kam nicht zustande, ebensowenig wie eine Einigung beim Kohleausstieg und der Kohlefinanzierung. Es bleibt nur zu hoffen, dass sich die Staaten bei der Klimakonferenz COP26 im November eines Besseren besinnen.
Corona: Rekord-Emissionen statt nachhaltigem Aufbau
Als eine internationale Studie unter Beteiligung des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung 2020 feststellten, dass die Corona-Pandemie für weniger CO2-Emissionen sorgte und dies in Ausmaßen, die selbst den Rückgang der CO2-Emissionen während der Ölkrise 1979 und der Finanzkrise 2008 übertraf, war das für sie nicht wirklich ein Grund zum Jubeln. Denn der Effekt sei nur von kurzer Dauer. Bei den meisten Volkswirtschaften sei der CO2-Ausstoß nach dem Lockdown wieder auf das ursprüngliche Maß gestiegen. Zudem können ein Rückgang menschlicher Aktivitäten nicht die Antwort auf die Klimakrise sein. „Worauf wir uns wirklich konzentrieren müssen, ist die Verringerung der CO2-Intensität unserer globalen Wirtschaft.“ Wovor die Forschenden schon damals warnten, zeigt sich nun deutlich: Statt die Wiederaufbauhilfen nachhaltig zu gestalten und so dauerhafte Krisen-Vorsorge zu betreiben, setzten Regierungen vor allem auf schnelles Wirtschaftswachstum. Das Ergebnis: Die globalen Treibhausgas-Emissionen werden in den nächsten zwei Jahren laut einer Vorraussage der Internationalen Energieagentur einen Höhepunkt erreichen, der den bisherigen Rekord in 2018 übertrifft. Gerade einmal 2% der Wiederaufbauhilfen in Corona-Zeiten gingen in Investitionen in erneuerbare Energien. Laut dem Direktor der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, müssen die reicheren Länder nun endlich ihr Versprechen einhalten, jährlich 100 Milliarden $ Klima-Finanzierung für Anpassungs- und Klimaschutzmaßnahmen für Länder des Globalen Südens zur Verfügung zu stellen – oder am besten mehr! Denn fast 90% der vorrausgesagten Emissionen kommen aus Ländern des Globalen Südens – während Länder des Globalen Nordens, deren Wohlstand auf jahrzehntelanger Anheizung der Klimakrise beruht, es sich aktuell leisten können, auf erneuerbare Energien umzusteigen.
EU – Fit for 55?
Die EU-Komission hat 13 neue oder novellierte Gesetzesvorschläge für mehr Klimaschutz vorgelegt. Diese sollten dazu führen, dass bis 2030 die Treibhausgas-Emissionen um 55% sinken. Das Ziel, auf das sich EU-Parlament und Komission nach langem Ringen im April verständigt hatten, ist zwar ambitionierter als die bisherigen Klimaziele der EU, allerdings immer noch nicht ausreichend um einen angemessenen Beitrag zum Pariser Klimaabkommen zu leisten. Das EU-Parlament hatte so z.B. 60% Reduktion bis 2030 gefordert und Umweltschützer*innen kritisierten, dass sogeannten CO2-Senken, also die natürliche Speicherung von CO2 in z.B. Wäldern und Mooren in die 55% eingerechnet werden können und die tatsächlichen Einsparungsziele nicht 55 %, sondern 52,8 % betragen. Aber immerhin legt die EU-Komission nun konkrete Maßnahmen vor, wie sie die 55% Reduktion erreichen wollen. So sollen Schiffe, ebenso wie es bereits bei innereuropäischen Flügen passiert, in den europäischen Emissionshandel einbezogen werden und die Preise für „Verschmutzungrechte“ steigen. Die nationalen Klimaziele der EU-Mitgliedsstaaten in den Bereichen Landwirtschaft, Verkehr, Gebäudewirtschaft und Abfälle sollen neu verhandelt werden. Zudem ist eine Umweltsteuer auf CO2-intensive Produkte der Aluminium-, Stahl-, Zement- und Düngemittel-Branche und für Elektrizitätserzeugung an den europäischen Außengrenzen geplant – da diese allerdings von den USA, China und vielen weiteren Ländern abgelehnt wird und gegen die Regeln der Welthandelsorganisation WHO verstoßen könnte, muss sich zeigen, ob sie tatsächlich in Kraft treten wird. Auch die geplante Veränderung der Besteuerung von Öl, Gas, Strom und Benzin hin zu einer Regelung, die fossile Energieträger nicht mehr begünstigt, ist noch nicht sicher. Die EU-Mitgliedsstaaten müssen nämlich einstimmig zustimmen. Ein Verbot von Verbrennungsmotoren ist – entgegen anderslautender Berichte aus Brüssel wenige Wochen vorher – nicht geplant. Doch die EU-Komission plant immerhin strengere Emissionsrichtwerte und möchte, dass ab 2050 alle Autos emissionsfrei fahren. Zudem sollen „nachhaltige“ Alternativen für Kerosin als Antrieb für Flugzeuge gefördert werden und Ausbau eines Zapfsäulensystems für Elektroautos und die Betankung mit Wasserstoff sollen verbindlich werden. Warum Wasserstoff allerdings nicht als Allheilmittel gehandelt werden darf, hat das Team des Klimareports euch hier zusammengefasst. Auch haben E-Autos einen hohen Bedarf an Rohstoffen wie Lithium und Kobalt, die häufig unter Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung im Globalen Süden abgebaut werden. Eine nachhaltige Verkehrspolitik, kann daher nicht einfach nur auf veränderte Antriebe setzen, sondern muss auch den Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln und die Förderung von Rad- und Fußverkehr voranbringen. Weiterhin soll es ein verbindliches Einsparungsziel für Energieeinsparung durch Wärmedämmung und energieeffizientes Bauen geben. Forst- und Landwirt*innen sollen in Zukunft nachweisen, dass sie jede Tonne CO2, die sie erzeugen, in Form von Bäumen oder anderen Pflanzen binden. Auch einen sozialen Ausgleich plant die EU-Kommission. 25% der Einnahmen aus dem Emissionshandel sollen in einen Klima-Sozialfonds fließen. Ob es tatsächlich zu diesen Maßnahmen kommen wird, bleibt allerdings weiterhin offen. Jetzt werden die Vorschläge ersteinmal von Verbänden, Umweltorganisationen, dem EU-Parlament und den Mitgliedstaaten analysiert. Die Mitgliedstaaten suchen eine gemeinsame Position zu den Vorschlägen der Komission und können dabei die Vorschläge auch noch verändern. Im September dann verhandeln sie mit den Abgeordneten des EU-Parlaments. Erst, wenn hier eine Einigung stattfindet, treten die Regelungen in Kraft.
Grünes Licht für Nordstream II – mit Vollgas in die Krise
Bis Ende des Jahres soll die umstrittene Gas-Pipeline Nordstream 2 anlaufen, nachdem die USA und Deutschland ihren Streit darüber beigelegt haben. Die Gas-Pipeline soll pro Jahr etwa 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus Russland nach Deutschland bringen. Das Milliardenprojekt ist aus vielfältigen Gründen höchst umstritten. Zum einen fühlen sich die Ukraine und Polen in ihrer Sicherheit bedroht, weil sie Angst haben, von der Erdgasversorgung abgeschnitten zu werden und es wird kritisiert, dass Europa sich zu sehr von Russland in der Energieversorgung abhängig macht. Zum anderen ist der Bau der Gas-Pipeline energiepolitisch unnötig und klima- und umweltpolitisch fatal. Die Pipeline gefährdet die Winterquatiere von Seetauschern und Meeresenten – und bei der Förderung, dem Transport und der Nutzung von Erdgas entstehen Methan-Emissionen. Schon jetzt befindet sich der Methangehalt in der Atmosphäre auf einem Rekord-Niveau. Es ist besonders gefährlich, weil es die Erderwärmung 25x schneller als CO2 anheizt. Energiepolitisch notwendig ist die Pipeline nicht – laut Energie-Expertin Prof. Claudia Kemfert gibt es bereits ausreichend Pipeline-Kapazitäten, Flüßiggasterminals und Transportrouten, die für den Transport des fossilen Erdgas ausreichen. Zur Einhaltung des 1,5°C-Limits müssen wir uns von der Gas-Nutzung verabschieden, statt diese noch weiter auszubauen.
Nach Klima-Urteil: Shell geht in Berufung
Der Ölkonzern „Shell“ ist nach eigenen Angaben überzeugt von Klimaschutz – das Bezirksgericht in Den Haag sah das jedoch anders und verurteilte Shell im Mai zu stärkeren Klimazielen. Die jetzigen Ziele seien „wenig konkret und voller Vorbehalte“, kritisierte das Gericht und ordnete an, dass Shell und seine Zulieferer*innen die von ihnen verursachten CO2-Emissionen um 45% bis 2030 verglichen mit 2019 senken müssen, da der Konzern die Zukunft der Niederländer*innen und der Bewohner*innen des Wattenmeers gefährde. Das Urteil aus Den Haag stellte einen bahnbrechenden Erfolg gegen Shell dar, da es nun Shell zwingt, konkrete Reduktionsziele einzuhalten. Nun geht der Ölkonzern, der laut dem Carbon Majors Report 2017 zu den klimaschädlichsten Unternehmen weltweit gehört, in Berufung gegen das Urteil. Dies ist aus Sicht des Ölkonzerns nur nachvollziehbar. Daran, dass das Urteil des Bezirkgerichts ein wegweisendes Urteil war, das als historisch bezeichnet werden kann, ändert dies nichts.